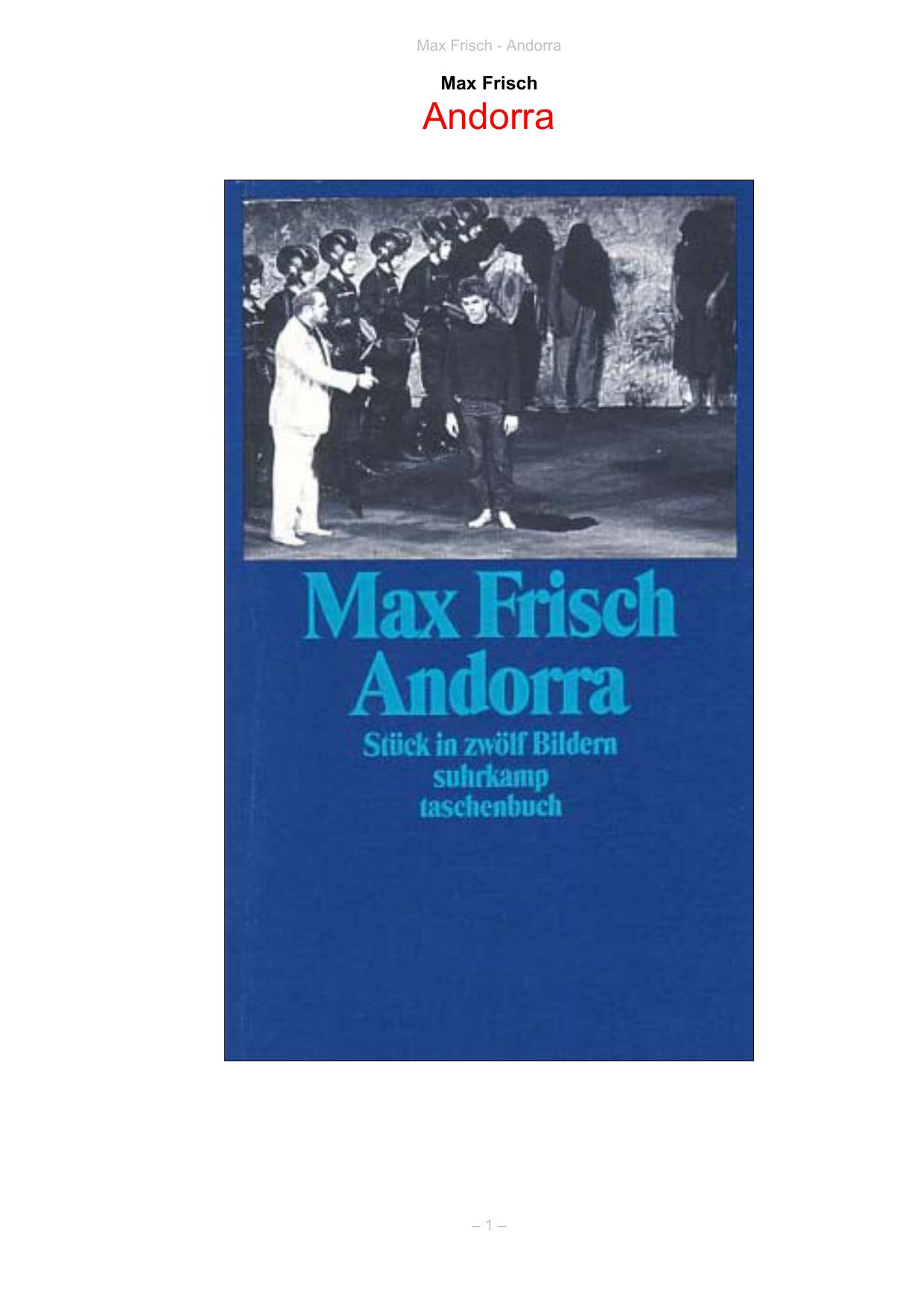![Ich hab dich im Gefühl]()
Ich hab dich im Gefühl
hängt, und ich schließe rasch die Augen.
Ich bin noch nicht bereit. Mir ist das alles nicht passiert, es wird erst wirklich, wenn jemand es mir sagt. Aber bis dahin bleibt die letzte Nacht in meinen Gedanken nur ein Albtraum. Je länger ich die Augen schließe, desto länger wird alles so bleiben, wie es war. Ich verharre in seliger Unwissenheit.
Jetzt höre ich, wie er in seinem Mantel herumkramt, ich höre Kleingeld klappern, dann das Klirren, als die Münze in den Schlitz am Fernseher fällt. Ich wage es, die Augen zu öffnen, und tatsächlich, da sitzt er wieder im Sessel, die Kappe hüpft, die Fäuste werden geschwenkt.
Zwar ist mein Vorhang zugezogen, aber ich spüre, dass ich den Raum mit anderen Menschen teile. Natürlich weiß ich nicht, mit wie vielen. Es ist ganz still, stickig, ich kann schalen Schweiß riechen. Die großen Fenster, die links von mir die ganze Wand einnehmen, sind geschlossen. Das Licht ist so hell, dass ich nicht hinaussehen kann. Erst nach einer Weile haben sich meine Augen daran gewöhnt, und ich erkenne eine Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite. Dort wartet eine Frau, Einkaufstüten zwischen den Füßen, ein Baby auf der Hüfte, das in der Spätsommersonne mit seinen feisten Beinchen baumelt. Schnell sehe ich weg. Dad beobachtet mich. Er beugt sich über die Armlehne nach hinten und verdreht den Kopf, wie ein Kind im Kinderbettchen.
»Hallo, Liebes.«
»Hallo.« Ich habe so lange nichts gesagt, deshalb erwarte ich, dass nur ein Krächzen herauskommt. Aber nichts dergleichen. Meine Stimme ist rein und klar. Als wäre nichts passiert. Aber es ist ja auch nichts passiert. Nicht, bevor sie es mir sagen.
Beide Hände auf die Armlehnen gestützt, erhebt sich mein Vater langsam. Wippend geht er zum Bett. Rauf und runter. Er ist mit verschieden langen Beinen auf die Welt gekommen, sein rechtes Bein ist kürzer als das linke. Obwohl er inzwischen Spezialschuhe trägt, schwankt er immer noch, wahrscheinlich weil er die Bewegung intus hat, seit er laufen gelernt hat. Er zieht die Schuhe auch höchst ungern an, und unseren Warnungen und seinen Rückenschmerzen zum Trotz kehrt er immer wieder zu dem zurück, was er kennt. Ich bin so daran gewöhnt, dass sein Körper rauf und runter geht, runter und rauf, und ich weiß noch genau, wie ich als Kind beim Spazierengehen seine Hand gehalten habe, immer die linke. Wie sich mein Arm dann im gleichen Rhythmus bewegt hat wie er. Wenn das rechte Bein aufkam, wurde ich nach oben gezogen, beim linken nach unten gedrückt.
Er war immer so stark, so belastbar. Ständig dabei, irgendwas zu reparieren. Immer hatte er einen Schraubenzieher in der Hand, schraubte Sachen auseinander und montierte sie wieder zusammen – Fernbedienungen, Radios, Wecker, Elektrostecker. Der Handwerker für die ganze Straße. Seine Beine waren ungleich, aber seine Hände fest und absolut zuverlässig.
Als er sich mir nähert, nimmt er die Kappe ab, packt sie mit beiden Händen und dreht sie wie ein Steuerrad, während er mich besorgt mustert. Er tritt mit dem rechten Bein auf. Runter. Beugt das linke. Seine Ruhehaltung.
»Bist du … äh … die haben mir gesagt … äh.« Er räuspert sich. »Die haben mir gesagt, ich soll …« Wieder schluckt er schwer, seine dichten, struppigen Augenbrauen ziehen sich zusammen und verbergen seine Augen. »Du hast … du hast …«
Meine Unterlippe beginnt zu zittern.
Als er weiterspricht, klingt seine Stimme ganz heiser. »Du hast eine Menge Blut verloren, Joyce. Sie …« Er nimmt die eine Hand von der Mütze, bewegt den gekrümmten Finger im Kreis und versucht sich zu erinnern. »Sie haben eine Transfusion mit diesem Blutdings gemacht, und jetzt bist du … äh … jetzt hast du genug.«
Aber meine Unterlippe zittert immer noch, und meine Hände wandern automatisch zu meinem Bauch, der noch nicht einmal so dick ist, dass man es unter der Decke erkennen kann. Hoffnungsvoll sehe ich meinen Vater an, und erst jetzt wird mir klar, wie sehr ich mich noch daran klammere, wie sehr ich mir eingeredet habe, dass der schreckliche Vorfall im Kreißsaal nur ein Albtraum war. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet, dass mein Baby so stumm war, dieses Schweigen, das sich in diesem letzten Moment im Raum ausgebreitet hat. Vielleicht hat es geschrien, aber ich habe es nicht gehört. Natürlich ist das möglich – in diesem Stadium war ich schon ziemlich fertig und nur noch halb bei Bewusstsein –, vielleicht habe ich den
Weitere Kostenlose Bücher