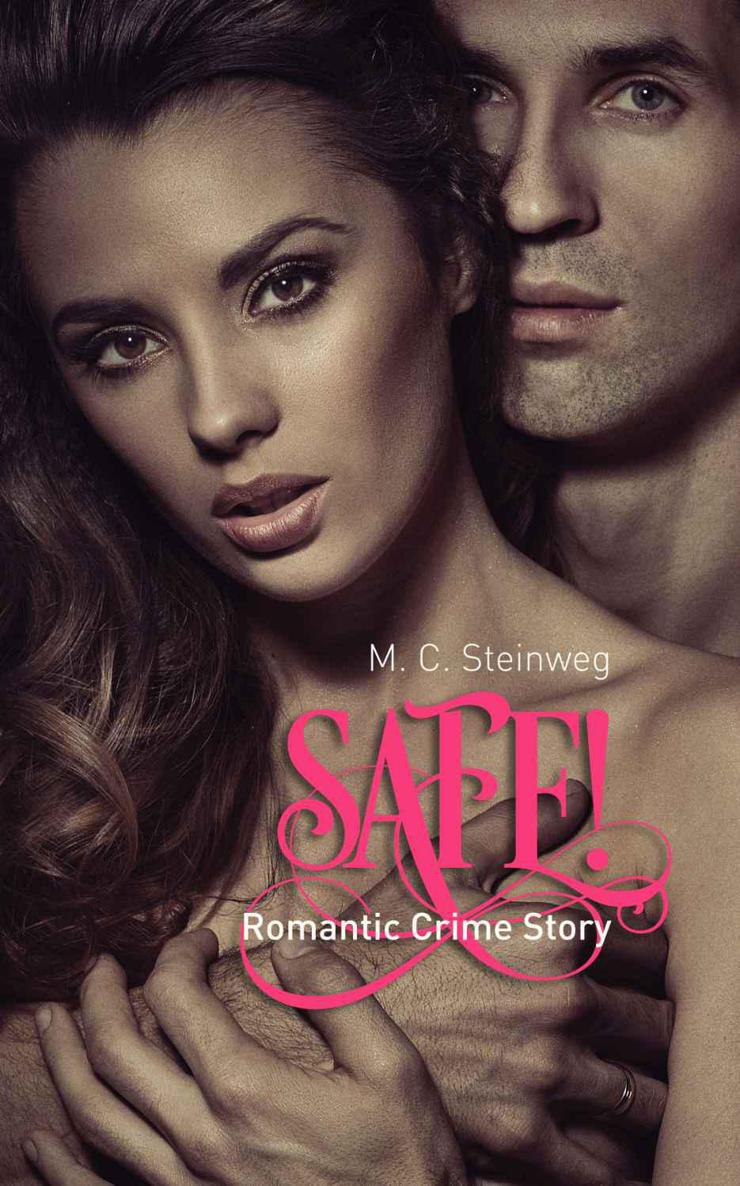![Mord an der Mauer]()
Mord an der Mauer
dokumentarisch einmaligen Aufnahmen vom Abtransport Peter Fechters schlummern vergessen im Stasiarchiv.
Der Fall der Mauer bedeutet für die Familie von Peter Fechter einen Wendepunkt – das Ende eines fast 30 Jahre langen Kampfes für die Erinnerung und des Ringens mit dem Vergessen. Am 17. November 1989 steht Margarete Fechter vor dem Mahnmal, ihren Hut ins Gesicht gezogen, in ihren Händen, die in dünnen Lederhandschuhen stecken, hält sie einen Blumenstrauß. Nicht allein das kalte Wetter lässt die kleine, sichtbar gealterte Frau frösteln. Tränen rollen ihr über die Wangen, als sie das Kreuz und das Foto ihres niedergeschossenen Sohnes sieht. Dass sie kurz zuvor beim Grenzübertritt lediglich ihren Ausweis hat vorweisen müssen und ohne Probleme einen Stempel bekam, kann sie kaum fassen. Eine Reporterin der Bild am Sonntag begleitet sie den ganzen Tag durch West-Berlin, zum Mahnmal und zum Kurfürstendamm. Als sie abends zurück nach Weißensee fährt, bedankt sie sich bei allen, »die all die Jahre an Peter gedacht haben. Es ist gut, zu wissen, dass man ihn nicht vergessen hat.« Der Bericht über ihren Besuch rührt die Leser: Sie überhäufen Margarete Fechter zu Weihnachten 1989 mit Päckchen und Briefen.
Im August 1990 ändert sich das öffentliche Gedenken an Peter Fechter. Zum ersten Mal richten der Senat von West- und der Magistrat von Ost-Berlin am 13. August am Fechter-Mahnmal eine gemeinsame Veranstaltung aus. Ost-Berlins Oberbürgermeister Tino Schwierzina ruft zum Umdenken auf. »Nachdem die Mauer in der Stadt gefallen ist, geht es nun darum, auch die Mauern in den Köpfen einzureißen.« Innensenator Erich Pätzold, der den Regierenden Bürgermeister Walter Momper vertritt, wählt ein anderes Bild: »Zwar verschwindet der Betonwall aus dem Stadtbild, die offene Wunde schließt sich langsam. Eine Narbe aber wird immer bleiben.«
Aufarbeitung
K eine Strafe der Welt kann ein Verbrechen ungeschehen machen. Wenn aber die Täter ihre Schuld sühnen müssen, leiden die Angehörigen von Opfern immerhin etwas weniger. Umgekehrt schmerzt die verweigerte Aufklärung zusätzlich. Im Juni 1990 scheinen die DDR-Behörden auf Zeit zu spielen. An vielen Stellen Berlins schon rücken »Mauerspechte« mit Hammer und Meißel dem nun nicht mehr mörderischen ehemaligen Todesstreifen zu Leibe, beginnen Pioniere der Grenztruppen und der Volksarmee mit schwerem Gerät, die mächtigen Betonsegmente abzubauen. Während die beiden deutschen Staaten und die vier Siegermächte um Wege zur Einheit ringen, befragt der Fernsehjournalist Roland Jahn den höchsten Strafermittler der Nationalen Volksarmee. Vor laufender Kamera erklärt Militäroberstaatsanwalt Karl-Heinz Bösel, warum seine Behörde seit dem Mauerfall nur in elf von Dutzenden dokumentierten Todesfällen an der Grenze ermittelt: »Diese Fälle sind bekannt, aber es gibt keine Anzeigen zu diesen Fällen. Und es gibt gegenwärtig keine Grundlagen, diese Fälle anzugehen.« Auf Jahns Frage, ob die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet sei, gegen Gewalttäter zu ermitteln, antwortet Oberst Bösel: »Das ist Ihre Einschätzung, dass es sich um Gewalttäter handelt.« Damit gibt sich der Journalist nicht zufrieden und verweist auf das lange Sterben Peter Fechters. Kopfschüttelnd erklärt der uniformierte Oberstaatsanwalt: »Dieser Fall ist mir nicht bekannt.«
Die westlichen Medien sehen das ganz anders. Schon wenige Tage nach dem Fall der Mauer ist Ruth Fechters Tochter Simone bei einem Besuch ihrer Großmutter in der Behaimstraße aufgefallen, wie westliche Autos den ganzen Innenhof des Hauses füllen, unter anderem Fahrzeuge mit Bonner Kennzeichen. Die kleine Wohnung von Margarete Fechter ist voller Journalisten. Um den 19. November 1989 herum erscheinen in verschiedenen westdeutschen Blättern Berichte über ihr Leben und ihre Trauer um den Sohn. Sie sagt zwar, es werde ihr »schönstes Weihnachten seit Peters Tod« werden, doch der Rummel um ihre ganz private Tragödie überfordert sie, wie Simone glaubt: »Für meine Großmutter ist das zu viel gewesen. Dass die Geschichte mit solcher Wucht wieder hochkommt.« Tatsächlich fragt sich Margarete Fechter angesichts der neuen Reisefreiheit: »Jetzt dürfen alle hin und her fahren. Warum durfte mein Sohn das nicht? Warum musste er sterben?«
Als Roland Jahn die Schwestern des Opfers ein halbes Jahr später mit der Feststellung des Militärjuristen Bösel konfrontiert, den Fall nicht zu kennen,
Weitere Kostenlose Bücher