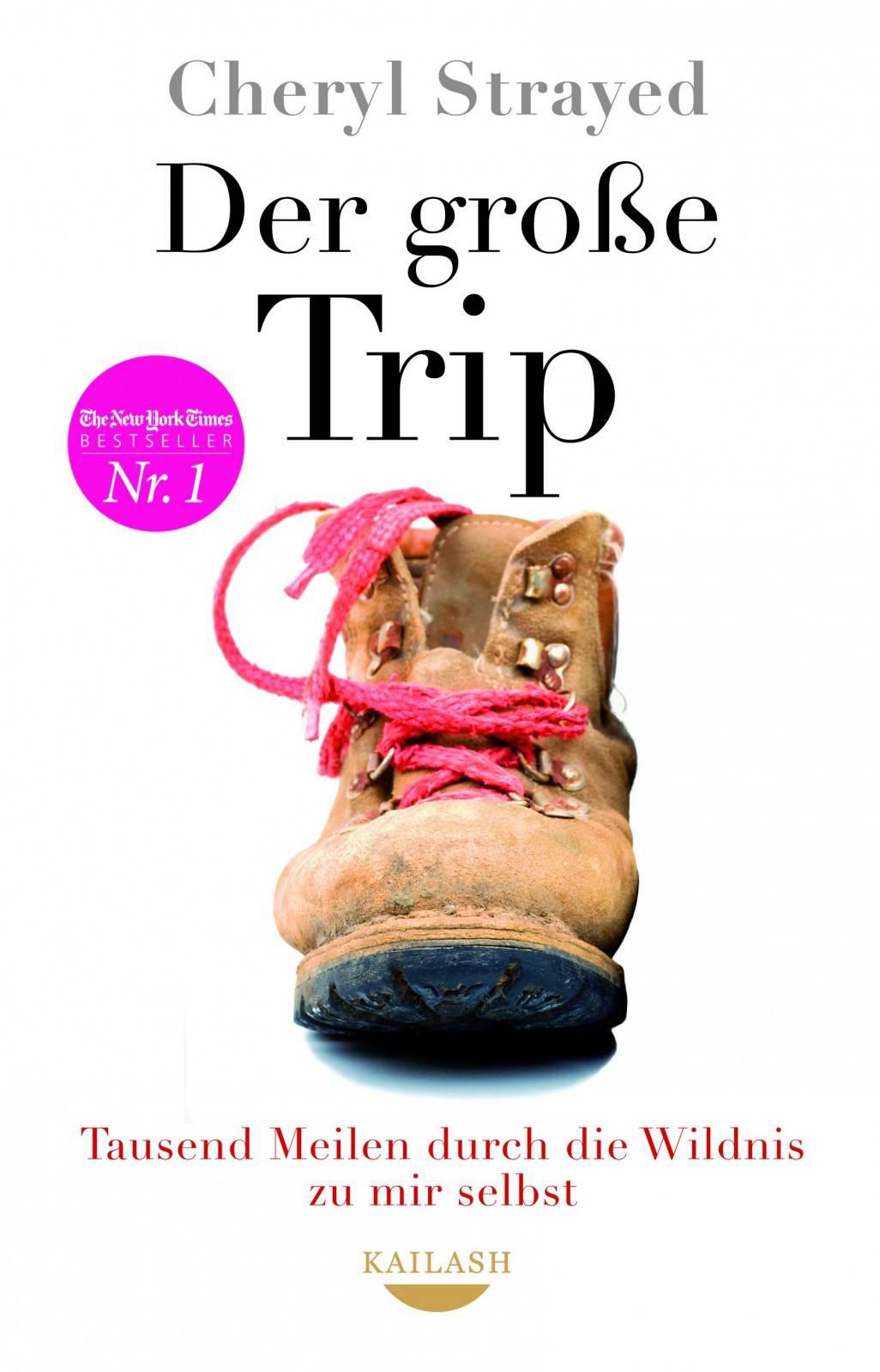![Der große Trip: Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst (German Edition)]()
Der große Trip: Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst (German Edition)
an zwei Tagen in der Woche am Vorlesungsbetrieb teilzunehmen. Sobald diese zwei Tage vorbei waren, raste ich nach Hause zu meiner Mutter. Im Unterschied zu Leif und Karen, die es kaum ertrugen, auch nur eine Stunde mit unserer Mutter zusammen zu sein, seit sie krank war, konnte ich es nicht ertragen, von ihr getrennt zu sein. Außerdem wurde ich gebraucht. Eddie war bei ihr, wann immer er konnte, aber er musste arbeiten. Jemand musste die Rechnungen bezahlen.
Ich kochte für meine Mutter, und sie versuchte zu essen, brachte aber selten etwas herunter. Erst hatte sie Hunger, dann saß sie wie ein Sträfling vor ihrem Teller und starrte auf das Essen. »Es sieht gut aus«, sagte sie. »Ich glaube, ich werde es später essen können.«
Ich schrubbte die Böden. Ich räumte die Schränke aus und legte sie mit frischem Papier aus. Meine Mutter schlief und stöhnte und zählte und schluckte ihre Tabletten. An guten Tagen saß sie in ihrem Sessel und sprach mit mir.
Es gab nicht viel zu sagen. Sie war so mitteilsam und auskunftsfreudig und ich so wissbegierig gewesen, dass wir alles schon beackert hatten. Ich wusste, dass ihre Liebe zu mir größer war als die zehntausend Dinge und auch die zehntausend Dinge darüber hinaus. Ich kannte die Namen der Pferde, die sie als Mädchen geliebt hatte: Pal, Buddy und Bacchus. Ich wusste, dass sie ihre Jungfräulichkeit mit siebzehn an einen Jungen namens Mike verloren hatte. Ich wusste, wie sie im Jahr darauf meinen Vater kennengelernt und welchen Eindruck sie bei ihren ersten Dates von ihm gehabt hatte. Ich wusste, dass ihrem Vater der Löffel aus der Hand gefallen war, als sie zu Hause verkündete, dass sie schwanger sei. Dass sie es verabscheut hatte, zur Beichte zu gehen, und auch die Dinge, die sie gebeichtet hatte. Dass sie geflucht hatte und zu ihrer Mutter frech gewesen war, dass sie gemeckert hatte, wenn sie den Tisch decken musste, während ihre viel jüngere Schwester spielte. Dass sie an Schultagen morgens in einem Kleid aus dem Haus gegangen und unterwegs in eine Jeans geschlüpft war, die sie heimlich in ihrer Tasche mitnahm. Meine ganze Kindheit und Jugend hindurch löcherte ich sie mit Fragen, ließ mir diese und andere Szenen schildern, wollte wissen, wer was und wie gesagt hatte, was sie dabei empfunden hatte, wo dieser und jener gestanden hatte und wie spät es gewesen war. Und sie hatte es mir erzählt, mal widerstrebend, mal genüsslich, lachend und mich fragend, warum um alles in der Welt ich das wissen wolle. Ich wollte es einfach wissen. Ich konnte es nicht erklären.
Aber jetzt, wo sie todkrank war, wusste ich alles. Meine Mutter war bereits in mir. Nicht nur das von ihr, was ich kannte, sondern auch das, was vor mir gewesen war.
Ich musste nicht lange zwischen Minneapolis und zu Hause pendeln. Etwas mehr als einen Monat. Dass meine Mutter noch ein Jahr zu leben hätte, erwies sich rasch als traurige Illusion. Am 12. Februar waren wir in der Mayo Clinic gewesen. Am 3. März musste sie ins Krankenhaus im hundertzehn Kilometer entfernten Duluth, da sie unter starken Schmerzen litt. Beim Ankleiden zu Hause gelang es ihr nicht, ihre Socken allein anzuziehen. Sie rief mich ins Zimmer und bat mich, ihr zu helfen. Sie saß auf dem Bett, und ich kniete mich vor sie hin. Ich hatte noch nie einem anderen Menschen Socken angezogen, und es war schwieriger, als ich gedacht hatte. Sie wollten einfach nicht über ihre Haut rutschen. Und wenn, dann saßen sie schief. Ich wurde wütend auf meine Mutter, als halte sie ihren Fuß absichtlich so, dass es mir unmöglich war. Sie saß zurückgelehnt da, mit den Händen auf dem Bett abgestützt, die Augen zu. Ich hörte, wie sie tief und langsam atmete.
»Verdammt noch mal«, schimpfte ich. »Hilf mir!«
Sie schlug die Augen auf und sagte eine Weile kein Wort.
»Schatz«, seufzte sie schließlich, sah mich fest an und strich mir über den Kopf. So hatte sie mich oft genannt, als ich noch ein Kind war, immer in einem ganz speziellen Ton. Das passt dir nicht, hatte dieses »Schatz«zu bedeuten,aber so sind die Dinge nun mal.Es war dieses Sichabfindenmit dem Leiden, was mich am meisten an meiner Mutter ärgerte, ihr ewiger Optimismus und Lebensmut.
»Lass uns gehen«, sagte ich, nachdem ich ihr mühsam die Schuhe angezogen hatte.
Mit schwerfälligen Bewegungen zog sie ihren Mantel an. Beim Gang durchs Haus stützte sie sich an den Wänden ab. Ihre beiden geliebten Hunde folgten ihr, rieben ihre Schnauzen an ihren Händen und
Weitere Kostenlose Bücher