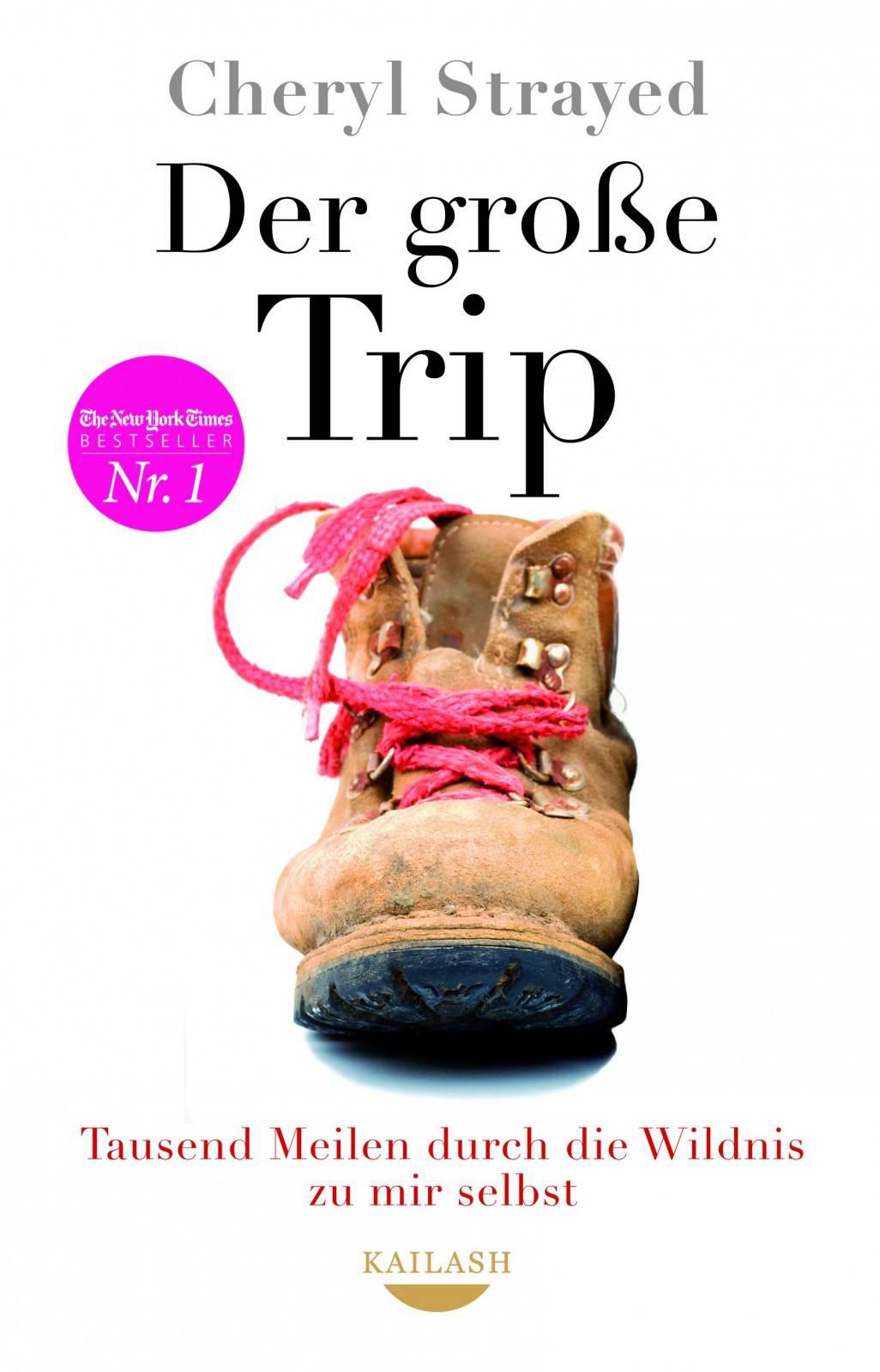![Der große Trip: Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst (German Edition)]()
Der große Trip: Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst (German Edition)
Oberschenkeln. Ich sah zu, wie sie ihnen den Kopf tätschelte. Ich hatte kein Gebet mehr. Die Worte Zum Teufel mit ihnen waren trockene Pillen in meinem Mund.
»Wiedersehen, meine Lieblinge«, sagte sie zu den Hunden. »Wiedersehen, Haus«, sagte sie, als sie mir zur Tür hinaus folgte.
Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter sterben könnte. Bis sie tatsächlich starb, war mir diese Möglichkeit nie in den Sinn gekommen. Sie war ein unüberwindlicher Fels, die Hüterin meines Lebens. Sie würde alt werden und immer noch im Garten arbeiten. Dieses Bild war fest in meinem Kopf verankert wie eine ihrer Kindheitserinnerungen, die ich mir so haarklein von ihr hatte schildern lassen, dass ich mich an sie erinnerte, als wäre es meine eigene. Sie würde alt werden und schön bleiben wie Georgia O’Keeffe auf dem Schwarzweißfoto, das ich ihr einmal geschickt hatte. In den ersten Wochen nach dem Besuch in der Mayo Clinic klammerte ich mich an dieses Bild. Doch als sie in das Hospiz des Krankenhauses in Duluth aufgenommen wurde, verblasste dieses Bild, machte anderen Platz, bescheideneren und realistischeren. Ich stellte mir meine Mutter im Oktober vor, speicherte das Bild in meinem Kopf. Und dann im August und schließlich im Mai. Mit jedem Tag, der verging, fiel ein weiterer Monat weg.
An ihrem ersten Tag im Krankenhaus bot ihr eine Schwester Morphium an, doch sie lehnte ab. »Morphium geben sie Leuten, die sterben«, sagte sie. »Morphium bedeutet, dass keine Hoffnung mehr besteht.«
Aber sie hielt es nur einen Tag durch. Sie schlief und wachte, redete und lachte. Sie schrie vor Schmerzen. Tagsüber blieb ich bei ihr, nachts Eddie. Leif und Karen blieben weg, machten Ausflüchte, die ich nicht nachvollziehen konnte und die mich erbosten, obwohl es meiner Mutter offenbar nichts ausmachte, dass sie nicht kamen. Sie war nur damit beschäftigt, die Schmerzen niederzuhalten, was in der Zeit zwischen den Morphiumgaben ein aussichtsloser Kampf war. Wir schafften es nie, die Kissen richtig hinzulegen. Eines Nachmittags trat ein Arzt, den ich noch nie gesehen hatte, ins Zimmer und erklärte, dass meine Mutter im Sterben liege.
»Aber es ist erst ein Monat vorbei«, protestierte ich empört. »Der andere Arzt hat von einem Jahr gesprochen.«
Er gab keine Antwort. Er war jung, vielleicht dreißig. Er stand neben dem Bett meiner Mutter und sah, eine zarte, behaarte Hand in der Tasche, auf sie hinab. »Von jetzt an ist unsere einzige Sorge, dass sie sich wohlfühlt.«
Dass sie sich wohlfühlt – und dennoch gab man ihr so wenig Morphium wie möglich. Unter dem Pflegepersonal war auch ein Mann. Einmal, als er da war, konnte ich die Umrisse seines Penis durch seine enge weiße Hose sehen. Am liebsten hätte ich ihn in das kleine Badezimmer am Fußendes des Bettes gezerrt und mich ihm dargeboten, mich überhaupt zu allem bereit erklärt, wenn er uns nur half. Aber ich wollte auch selbst meinen Spaß dabei haben, das Gewicht seines Körpers auf meinem spüren, seinen Mund in meinem Haar spüren, ihn meinen Namen sagen hören, immer und immer wieder, ihn zwingen, von mir Notiz zu nehmen, unsere Sache zu seiner zu machen, seinem Herzen Mitleid mit uns abzuringen.
Wenn meine Mutter ihn um mehr Morphium bat, dann in einer Weise, wie ich nie jemanden um etwas bitten gehört hatte. Aber der Kerl sah sie dabei nie an, sondern immer nur auf seine Armbanduhr. Er verzog keine Miene, egal wie seine Antwort lautete. Manchmal gab er ihr das Morphium ohne ein Wort, und manchmal sagte er Nein mit einer Stimme, die so weich war wie der Penis in seiner Hose. Dann flehte und wimmerte meine Mutter. Sie weinte, und ihre Tränen rollten in die falsche Richtung. Nicht über ihre Wangen hinunter zu den Mundwinkeln, sondern weg von den Augenrändern zu den Ohren und in das Knäuel ihrer Haare auf dem Kissen.
Sie lebte kein Jahr mehr. Sie lebte auch nicht bis Oktober, August oder Mai. Sie lebte noch neunundvierzig Tage, nachdem ihr der erste Arzt in Duluth eröffnet hatte, dass sie Krebs habe. Noch vierunddreißig Tage, nachdem der andere in der Mayo Clinic die Diagnose bestätigt hatte. Tag folgte auf Tag, aber jeder war eine Ewigkeit, ein kaltes Licht im dichten Nebel.
Leif besuchte sie nie. Karen kam ein einziges Mal, nachdem ich darauf bestanden hatte. Ich war untröstlich, wütend, fassungslos. »Ich möchte sie nicht in diesem Zustand sehen«, führte meine Schwester immer wenig überzeugend als Grund an, wenn wir miteinander sprachen, und
Weitere Kostenlose Bücher