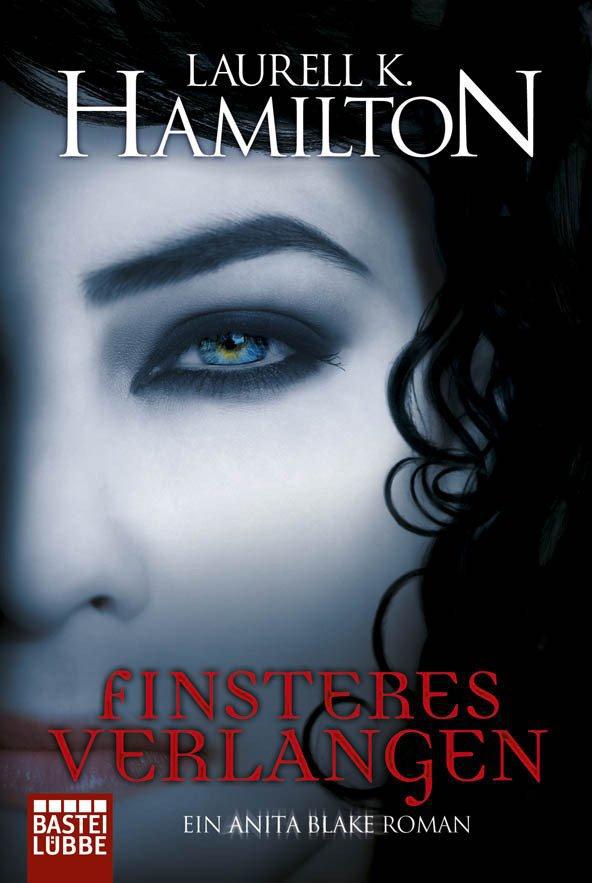![Finsteres Verlangen]()
Finsteres Verlangen
dunkle Seite des Mondes und genauso fröhlich. Ich mag lieber Friedhöfe mit aufrechten Grabsteinen und Gruften, mit Engeln, die über Kinderbildern weinen, und mit Heiligen Jungfrauen, die die Augen zum Himmel erheben und für uns alle beten. Ein Friedhof sollte den Menschen in Erinnerung rufen, dass es einen Himmel gibt und nicht bloß ein Loch in der Erde mit einem Stein darüber.
Ich war dort, um Gordon Bennington von den Toten zu erwecken, weil die Versicherungsgesellschaft Fidelis hoffte, er sei nicht verunglückt, sondern habe sich umgebracht. Mehrere Millionen Dollar standen auf dem Spiel. Die Polizei hatte den Tod als Unfall deklariert, aber Fidelis gab sich damit nicht zufrieden. Sie zahlten lieber mein beträchtliches Honorar, in der Hoffnung, Millionen zu sparen. Ich war teuer, aber nicht so teuer. Verglichen damit, was sie der Witwe zu zahlen hätten, war ich ein Schnäppchen.
Auf dem Friedhof standen drei Gruppen von Fahrzeugen. Zwei davon mindestens fünfzehn Meter weit auseinander, weil Mrs Bennington und Arthur Conroy, der Chefanwalt von Fidelis, jeweils ein Kontaktverbot erwirkt hatten. Die dritte Gruppe parkte zwischen den beiden: ein Streifenwagen und ein Zivilfahrzeug der Polizei. Fragen Sie mich nicht, wieso ich wusste, dass dieser ungekennzeichnete Wagen der Polizei gehörte. Er sah einfach so aus.
Ich parkte ein wenig abseits von den anderen. Ich fuhr einen nagelneuen Jeep Grand Cherokee, den ich zum Teil mit dem Geld finanziert hatte, das ich für meinen dahingeschiedenen Country Squire bekommen hatte. Die Versicherung hatte nicht zahlen wollen. Sie glaubte nicht, dass der Country Squire von Werhyänen gefressen worden war. Sie schickte ein paar Leute raus, die die Schäden fotografierten und sich die Blutflecken ansahen. Dann zahlten sie doch, kündigten mir aber. Jetzt zahle ich monatlich an eine andere Versicherung, die mir Vollkasko gewährt, sofern es mir gelingt, meinen neuen Wagen ganze zwei Jahre lang heil zu lassen. Die Chancen sind enorm.
Meine Sympathie gehörte der Familie Gordon Benningtons. Klar, es ist schwer, mit einer Versicherungsgesellschaft zu sympathisieren, die sich davor drücken will, eine Witwe mit drei Kindern auszuzahlen.
Die Wagen, die mir am nächsten standen, gehörten den Fidelis-Mitarbeitern, wie sich herausstellte. Arthur Conroy kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Er rangierte am oberen Ende von »klein«, hatte schütteres, blondes Haar, das er über seinen kahlen Fleck kämmte, als ließe der sich dadurch verbergen, und trug eine silberne Brille vor seinen großen grauen Augen. Wären seine Wimpern und Brauen dunkler gewesen, hätte man die Augenpartie als bemerkenswert bezeichnen können. Doch die Augen waren so groß und nackt, dass sie etwas Froschartiges hatten. Aber vielleicht stimmte mich die jüngste Meinungsverschiedenheit mit meiner Versicherung auch ungnädig. Vielleicht.
Conroy kam mit einer Wand aus Bodyguards im Rücken. Ich schüttelte ihm die Hand und spähte an ihm vorbei auf die beiden dunkel gekleideten Zwei-Meter-Kerle.
»Leibwächter?«
Conroy riss die Augen auf. »Woher wissen Sie das?«
»Sie sehen so aus, Mr Conroy.«
Ich gab den zwei anderen Fidelis-Mitarbeitern die Hand, den Leibwächtern nicht. Die schütteln meistens keine Hand, selbst wenn man sie ihnen hinstreckt. Ob sie ihr hartes Image nicht ruinieren oder nur die Waffenhand freihaben wollen, weiß ich nicht. Jedenfalls bot ich keine an und sie ebenfalls nicht.
Der Dunkelhaarige von den beiden, der fast so breit wie hoch war, lächelte mich immerhin an. »Sie sind also Anita Blake.«
»Und Sie sind?«
»Rex, Rex Canducci.«
Ich zog die Brauen hoch. »Heißen Sie wirklich Rex mit Vornamen?«
Er platzte mit diesem überraschten, lauten Lachen heraus, das so männlich war und meistens auf Kosten einer Frau ging. »Nein.«
Ich verzichtete auf die Frage, wie er in Wirklichkeit hieß; vermutlich war es etwas Peinliches wie Florence oder Rosie. Der andere Leibwächter war blond und still. Er beobachtete mich aus kleinen, hellen Augen. Er war mir unsympathisch.
»Und Sie sind?«, fragte ich.
Er sah mich groß an, als überraschte ihn meine Frage. Die meisten Leute ignorieren Leibwächter, die einen aus Angst oder weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, die anderen, weil sie an solche Männer gewöhnt sind und denken, sie seien wie Möbelstücke, die man erst beachtet, wenn man sie braucht.
Er zögerte, dann sagte er: »Balfour.«
Ich wartete eine
Weitere Kostenlose Bücher